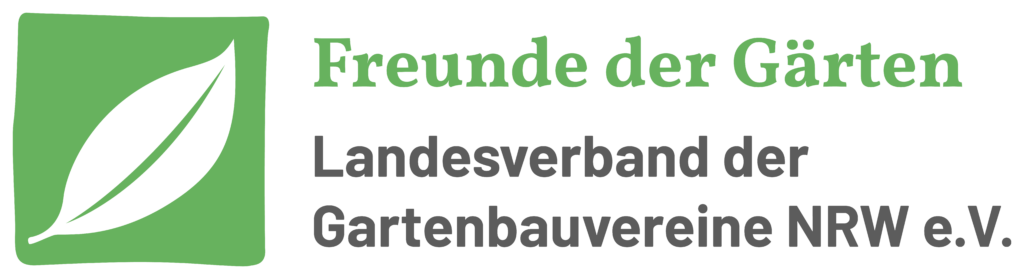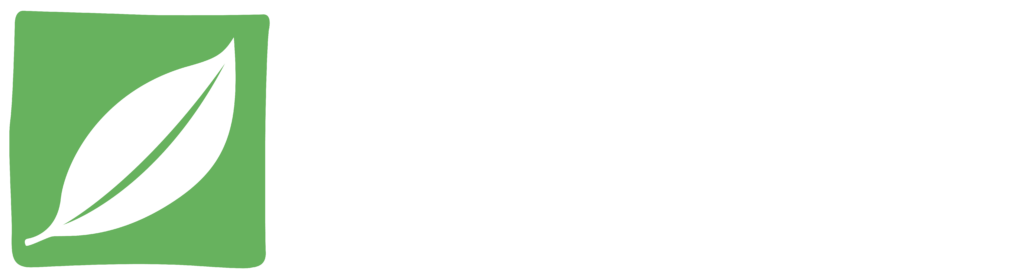„Fake News“, also falsche oder irreführende Nachrichten, gibt es mittlerweile überall – warum nicht auch im Garten?! Denken wir da nur an die Hinweise auf den Samentüten oder in Gartenprospekten, die oftmals viel versprechen, aber immer wieder für Enttäuschungen sorgen, wenn die Blütenpracht ausbleibt oder der Geschmack und die Größe der Früchte zu wünschen übrig lässt. In den folgenden Zeilen soll es allerdings weniger um „Fake News“ als um „Fake Oldies“ gehen; soll heißen, dass Garteninformationen, auch wenn sie überall immer wieder erwähnt werden, nicht richtig sein müssen. Jeder kennt z.B. die Sache mit dem anscheinend hohen Eisengehalt des Spinats, der sich schließlich als bloßer Kommafehler entpuppte, aber jahrzehntelang als Tatsache dargestellt wurde.
Diese Fehlinformationen sind natürlich kein Phänomen der heutigen Zeit. Schon vor über 100 Jahren gab es Irrtümer oder Falsch-Auskünfte, wie zum Beispiel in dem Buch „Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen“ von Henriette Davidis in der Ausgabe von 1880. Es war seinerzeit eines der gebräuchlichsten Gartenbücher. Darin steht unter der Kategorie Schädlinge: Regenwurm. Es wurde genau erläutert, mit welchen Methoden er zu vernichten sei. Heute wissen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist: der Regenwurm ist ein wichtiger Helfer im Garten! Lange hielt sich auch die irrige Meinung, dass durch das Zerteilen eines Regenwurms zwei neue Individuen entstünden. Heute wissen wir, dass höchstens der Teil mit dem Kopf eine Chance auf Weiterleben hat. Wie viele Gärtner haben wohl aufgrund dieses Unsinns und im guten Glauben diese nützlichen Tiere getötet!?